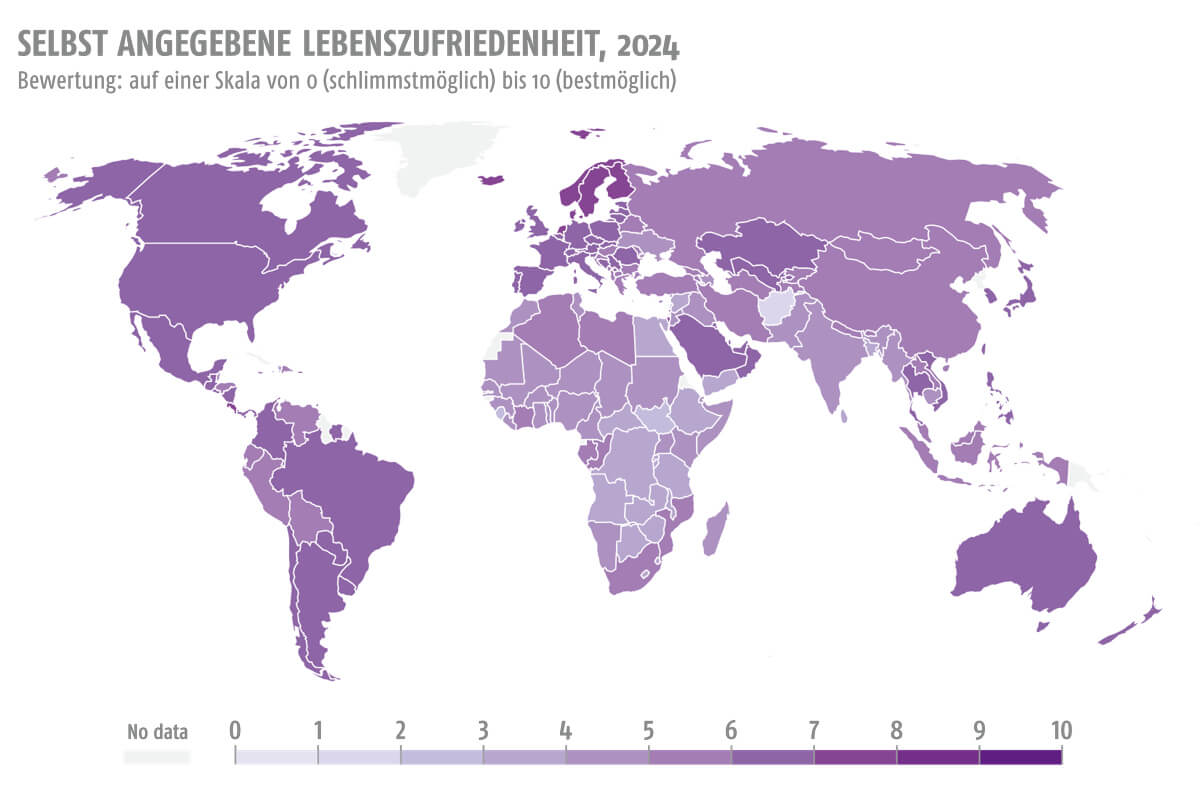Die Modernisierung Äthiopiens unter Meles Zenawi scheint auf halbem Wege steckengeblieben und politische Freiräume für die Opposition tun sich kaum auf. Mit fragwürdigen Gesetzen will sich der amtierende Premier nun einen erneuten Wahlsieg 2010 sichern.
Wer in langen Zeiträumen denkt – und bei Äthiopien mit seiner ununterbrochenen 4000-jährigen Geschichte von Staatlichkeit ist das angebracht – muss für das einstige Großreich in den Bergen am Horn von Afrika einen gewaltigen Sprung nach vorn feststellen. Vor einer Generation noch war Äthiopien der Inbegriff des Elends auf der Welt: Hort fürchterlicher Hungersnöte, ein Garnisonsstaat im Griff einer finsteren Militärdiktatur, Sinnbild für den aussichtslosen afrikanischen Pflegefall. Heute ist Äthiopien eine allmählich erwachende Großmacht, mit Wirtschaftswachstumsraten von jährlich zehn Prozent und mehr, als Stabilitätsfaktor in der Region umworben, und mit einer sich zwar sehr langsam, aber merklich entwickelnden sozialen und politischen Pluralität.
Aber ebenso wie andere afrikanische Staaten, die dank ihrer reformfreudigen Präsidenten in den 1990er Jahren die "afrikanische Renaissance" prägten, scheint Äthiopien in seiner Entwicklung auf halbem Wege steckengeblieben zu sein. Die Wirtschaft boomt, aber der Staat kann von seiner strikten Kontrolle vor allem über das Landeigentum nicht lassen. Addis Abeba wird zur lebenswerten und aufgeschlossenen Metropole, aber die entlegenen Provinzen scheinen noch immer in der Vergangenheit festgefahren. Die Menschen werden nicht mehr millionenfach vom Hunger dahingerafft, aber abgrundtiefe, ausweglose Armut ist noch immer das Los der Mehrheit einer unheimlich schnell wachsenden Bevölkerung von mittlerweile über 80 Millionen Menschen. Schlimmer noch: Die zarten Knospen von demokratischem Pluralismus, die sich noch vor wenigen Jahren regten, sind nie zu voller Blüte gereift, und es ist zunehmend fraglich, ob sie das jemals tun können.
Es war das Jahr 2005, als Äthiopien sich politisch zum großen Sprung nach vorn anschickte. Premierminister Meles Zenawi saß in Tony Blairs Reformkommission für Afrika, gefeiert als Visionär und Pragmatiker. Bei Parlamentswahlen im Mai gab es erstmals eine starke zivile Opposition gegen die regierende Ex-Guerilla EPRDF (Revolutionäre Demokratische Front der Äthiopischen Völker): die CUD (Koalition für Einheit und Demokratie). Die bislang so gut wie allein im Parlament herrschende EPRDF verlor ein Drittel ihrer Mandate, die CUD räumte in der Hauptstadt ab und beanspruchte sogar den Sieg im ganzen Land (siehe SWM 03/06).
Aber das offizielle Endergebnis bestätigte den Sieg der Regierungspartei. Bei gewaltsamen Ausschreitungen starben knapp 200 Menschen, die CUD-Führung wurde inhaftiert und zum Teil des versuchten Völkermordes angeklagt. Die politische Auseinandersetzung der Regierung mit der Opposition fand mit ungleichen Waffen statt: nicht im Parlament, sondern vor Gericht. Die Demokratisierung erstickte im Staub der Justizakten. Die Begnadigung der meisten Verurteilten im Jahr 2007 hat das politische Klima nicht wieder erwärmt, sondern eine demoralisierte politische Landschaft zurückgelassen, deren AkteurInnen nicht mehr wissen, was sie dürfen und was nicht.
Das lässt bewaffneten Gruppen, die vor allem in der Süd- und Osthälfte des Landes Richtung Somalia aktiv sind, breiten Raum. Sie verklären sich selbst als Avantgarde eines zunehmend ethnisch definierten Widerstandes gegen den Staat in Addis Abeba, worauf die Regierung wiederum mit zunehmend schrillen Anschuldigungen einer islamistisch-terroristischen Unterwanderung antwortet. Der alte Motor der äthiopischen Imperialgeschichte – ein starkes Zentrum im Hochland gegen eine mehr oder minder aufsässige Peripherie rundherum – läuft wieder reibungslos, und mit ihm die bewährte Maschine staatlicher Allmacht gegenüber kritiklosen Massen.
Mehrere Jahrtausende militarisierter Staatsgeschichte lassen sich eben nicht in wenigen Jahren wirkungslos machen. Äthiopien war ein altes Kaiserreich der Amharen im zentralen Hochland und als einziges afrikanisches Großreich nie europäisch kolonisiert. 1974 stürzte eine Gruppe junger amharischer Offiziere den Kaiser Haile Selassie und errichtete innerhalb allgemeiner Wirren eine erst bizarre und dann verknöcherte, marxistisch ausgerichtete Volksrepublik. Dass die allermeisten Menschen im Vielvölkerstaat Äthiopien sich weiterhin von der Macht ausgeschlossen fühlten, ignorierten die Diktatoren im Namen eines sozialistischen Menschenbildes, das im Land niemand verstand. Im einst italienisch kolonisierten Küstenstreifen Eritrea, im unmittelbar südlich davon gelegenen Hochland Tigray sowie in den zentralen und östlichen Siedlungsgebieten des Oromo-Volkes regten sich bewaffnete Befreiungsbewegungen, die immer stärker wurden, während die Nachbarstaaten Sudan und Somalia in den späten 1980er Jahren zunehmend ins Chaos schlitterten. Als die Tage der Volksrepublik des Diktators Mengistu Haile Mariam gezählt waren, organisierten US-Diplomaten zwischen den drei großen Rebellenbewegungen – der Eritreischen Volksbefreiungsfront (EPLF) in Eritrea, der Tigray-Volksbefreiungsfront (TPLF) und der Oromo-Befreiungsfront (OLF) – einen Ausgleich, der ihnen am 28. Mai 1991 gemeinsam die unblutige Machtübernahme ermöglichte.
Aber in der Folge monopolisierte die TPLF, die sich unter Meles Zenawi einen gesamtäthiopischen Anspruch unter dem Namen EPRDF (Revolutionäre Demokratische Front der Äthiopischen Völker) gab, die Macht in Addis Abeba. Eritrea bekam die ersehnte Unabhängigkeit. Die Oromo gingen leer aus, wie schon immer in der äthiopischen Geschichte. Sie zogen sich zurück in die ihnen vertraute Staatsferne, in der vor allem die Waffen sprechen. Die entmachteten Amharen wiederum schmollten in der Hauptstadt und erklärten sich zur demokratischen Opposition gegen die unzivilisierten Tigray-Widerstandskämpfer. Da Amharen und Oromo einander spinnefeind waren und sind, konnte daraus keine Gefahr für die EPRDF-Herrschaft entstehen. Meles Zenawi hielt seine Macht mit einer klugen Balance aus Föderalismus und nationaler Einheit. Er strafte damit all jene Behauptungen Lügen, wonach Äthiopiens absolutistischer Staat auf der Herrschaft der amharischen Minderheit gegründet sei. Seine Tigrays konnten das genauso gut. Gewissermaßen konnte dies sogar als Beweis gelten, dass es eine äthiopische Identität jenseits der Ethnie gab.
Selbst der Bruch mit den einstigen Verbündeten aus Eritrea änderte daran nichts; im Gegenteil. Der äthiopisch-eritreische Krieg von 1998-2000 mit 70.000 Toten, bei dem es vordergründig um ein paar Wüstenflecken ging und tatsächlich darum, wer die bessere Armee hat – TPLF oder EPLF -, festigte den äthiopischen Nationalismus wie kein Ereignis zuvor seit den Kriegen gegen Somalia in den 1970er Jahren. Äthiopien gewann auf dem Schlachtfeld, und damit bewies Meles Zenawi sich selbst. Der Krieg trieb in Äthiopien und auch in Eritrea die Militarisierung und Zentralisierung der Macht voran und ermöglicht es seither den Regierenden in Äthiopien wie in Eritrea, Opposition nach Belieben in die Nähe des Landesverrates zu rücken. Auch deshalb bleiben die Spannungen zwischen beiden Ländern bis heute so groß (siehe SWM 10/08), obwohl sie ihre bewaffnete Konfrontation inzwischen nicht mehr an der gemeinsamen Grenze austragen, sondern nebenan in Somalia: Äthiopien unterstützt die pro-westlichen Kräfte, Eritrea die radikalen Islamisten. Damit ist Äthiopien wichtigster Alliierter der USA in der Region und Eritrea Außenseiter. Auch das ist ein Erfolg von Meles Zenawi.
Seine GegnerInnen wachsen über die ihnen zugewiesenen Nebenrollen nicht hinaus. Die Oromo-Guerilla OLF und verbündete Gruppen wie die ONLF (Ogaden Nationale Befreiungsfront) bleiben im Osten des Landes aktiv, ebenso in der Hauptstadt die zivilen Oppositionsparteien wie die zur UEDF (Vereinigte Äthiopische Demokratische Kräfte) beziehungsweise UDJ (Union für Demokratie und Gerechtigkeit) mutierte CUD und andere amharisch dominierte Verbände. Aber die Politik Äthiopiens bleibt ein Nullsummenspiel zwischen ethnisch definierten Eliten, von denen sich keine eine wirkliche Volksbeteiligung an der politischen Diskussion auch nur ansatzweise vorstellen kann. Die Nachwahlen zum Parlament 2008 wurden von der Opposition boykottiert. Aus der somalisch besiedelten Ogaden-Wüste berichten die wenigen unabhängigen BeobachterInnen, die dorthin gelangen, von einer Politik der verbrannten Erde im Kampf gegen Rebellen.
Nur der Umstand, dass die Unterdrückung im benachbarten Eritrea noch weitaus härter ist, rückt Äthiopien in ein relativ mildes Licht. Immerhin gibt es keine Flüchtlingsströme verzweifelter ÄthiopierInnen durch den Sudan Richtung Libyen und Mittelmeer, so wie das aus Eritrea regelmäßig gemeldet wird – über Jahrzehnte hinweg können Männer wie Frauen dort zum Wehrdienst verpflichtet werden. Während Zehntausende EritreerInnen, darunter 5.000 SoldatInnen, Zuflucht in Äthiopien gesucht haben, beschränkt sich die Flucht in umgekehrte Richtung auf Angehörige eritreischer Etnien und auf politische AktivistInnen. Im Krieg in Somalia hat Äthiopiens Armee zwar Kriegsverbrechen begangen, vor allem durch den Beschuss von Wohnvierteln in der Hauptstadt Mogadischu 2007, blieb aber unter Kontrolle und zog 2008 planmäßig wieder ab.
Doch politische Freiräume wollen einfach nicht neu entstehen. Nach dem restriktiven Gesetz über Nichtregierungsorganisationen, das zivilgesellschaftliche Arbeit erheblich erschwert (siehe folgenden Beitrag von Marc Engelhardt) hat Äthiopiens Regierung im Juli dieses Jahres ein neues Anti-Terrorgesetz in Kraft gesetzt, das KritikerInnen als gezielte Sabotage der kommenden Wahlen im Jahr 2010 werten. Es definiert als "Terrorismus" jegliche Sachbeschädigung und Störung öffentlicher Dienstleistungen, worauf 15 Jahre Haft und in schweren Fällen sogar die Todesstrafe steht. Kein Geringerer als der langjährige Staatspräsident Negasso Gidada warf der Regierung Ende August vor, friedliche Versammlungen der politischen Opposition systematisch zu stören. In einem Brief an Premierminister Meles Zenawi schrieb sein alter Mitstreiter: "Die Klagen der oppositionellen politischen Parteien, wonach es keine demokratischen Freiräume gebe, sind völlig korrekt."
Ausgerechnet Premier Zenawi hat jüngst zugegeben, es sei wohl Zeit, dass eine neue Generation die Macht ergreife, die ihre Erfahrungen nicht auf dem Schlachtfeld gesammelt habe. Er will wohl erst, dass seine früheren und jetzt verfeindeten Waffenbrüder und alle Angehörigen der derzeit rivalisierenden ethnischen Eliten auf biologischem Wege von der Bühne verschwinden, bevor das Spiel neu beginnt. Die Frage bleibt, ob er mit dieser Sicht der Dinge die Geduld seiner BürgerInnen überschätzt. Vielleicht passt es aber auch einfach zum Rhythmus eines Landes, das es in seiner Geschichte noch nie eilig hatte und damit bisher immer ganz gut gefahren ist.
Dominic Johnson ist Afrika-Redakteur der Berliner Tageszeitung „taz“.